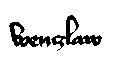
| Einführung in das Findmittel | 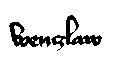 |

Inhalt:
1. Vorwort
2. Biographie Wenzels
3. Einführung in die Diplomatik der Wenzelurkunden
3.1 Der Relationskonzeptvermerk
3.2 Der Registervermerk
3.3 Klassifikation der Schriftstücke
3.3.1 Diplome
3.3.2 Mandate
3.3.3 Briefe
4. Die Siegel König Wenzels und seiner Hofrichter
5. Arbeitsprotokoll
5.1 Auswahl der relevanten Bestände
5.2 Durchsicht der Repertorien
5.3 Ausheben der Urkunden und Kopiare
5.4 Festlegung der Transkriptions- und Regestierungsrichtlinien
sowie der Formalbeschreibung
5.5 Bearbeitung der Urkunden und Durchsicht der Kopiare
5.6 Abgleich der Originale mit den Kopiaren
5.7 Arbeiten zur Erstellung des Findbuches
5.8 Richtlinien für Transkription, Regest und Formalbeschreibung
6. Auswahlbibliographie
7. Abkürzungen
1. Vorwort
Das vorliegende sachthematische Inventar über die im Staatsarchiv
Marburg in Ausfertigung oder Abschrift überlieferten Urkunden König
Wenzels ist aus einer Urkundenübung des 31. Wissenschaftlichen Kurses
der Archivschule Marburg heraus entstanden, die unter der Leitung von Dr.
Karsten Uhde im April 1997 stattfand. Vorausgegangen waren umfangreiche Recherchen in allen einschlägigen Beständen des Staatsarchivs Marburg, um die angestrebte Vollständigkeit zu
gewährleisten. Darüber hinaus wurde auch die wichtigste Forschungsliteratur
zu König Wenzel berücksichtigt, wobei hier vor allem die Untersuchung
von Hlavacek zu nennen ist, die als zentrales Hilfsmittel fungierte.
Anschließend wurden die aufgefundenen Archivalien gelesen, transkribiert und regestiert. Schließlich wurden die Formalbeschreibungen angefertigt. In einem zweiten Schritt wurde das Inventar mit einer Einleitung, den Regesten und zwei Indices angefertigt. Dabei besteht die Einleitung aus einigen kurzen Einführungen in Biographie, Diplomatik und Sphragistik sowie einem ausführlichen Arbeitsprotokoll und einer Literaturliste.
In einem letzten Schritt wurde das entstandene Inventar für
das Internet als Online-Findmittel auf der Basis einer Textdatei
aufgearbeitet, worüber ein Arbeitsbericht entstand.
| 1361 Februar 26 | Wenzel wird in Nürnberg geboren Vater: Karl IV. Mutter: Anna von Schweidnitz-Jauer |
| 1361 April 11 | Taufe auf den Premyslidennamen Wenzel durch den Erzbischof von Prag |
| 1363 Juni 15 | (Veitstag): Krönung als Wenzel IV. zum böhmischen König in Prag |
| 1365 September 29 | Hochzeit Wenzels mit Johanna, Tochter des Herzogs Albrecht I. von Bayern. Wenzel war insgesamt zweimal verheiratet; keine Kinder |
| 1376 Juni 10 | Wahl Wenzels zum römischen König durch die Kurfürsten in Frankfurt am Main |
| 1376 Juli 6 | Krönung in Aachen |
| 1376 November 29 | Tod Karls IV. |
| 1389 | Zweite Ehe mit Sophie von Bayern |
| 1393 | König Wenzel läßt als Folge einer Auseinandersetzung mit der Kirche in Böhmen in einem Wutanfall den Generalvikar des Erzbischofs Johannes von Jensenstein, Johannes von Nepomuk, gefangennehmen. Johannes von Nepomuk wird gefoltert und anschließend in der Moldau ertränkt. Dadurch verfestigte sich der gewaltätige Ruf Wenzels. |
| 1394 Mai- 1394 August |
1. Gefangennahme Wenzels, u.a. daran beteiligt: Jost von Mähren, Vetter Wenzels |
| 1397 Mai | Frankfurter Fürstentag: die Fürsten fordern König Wenzel auf, einen Stellvertreter im Reich einzusetzen. Daraufhin kommt er nach zehnjähriger Abwesenheit zurück in das Reich. |
| 1399 Mai- 1400 August 11 |
Absetzungsverhandlungen im Reich. Die Kurfürsten von Mainz, Köln, Trier und der Pfalz treffen in Oberlahnstein zusammen, um die Absetzung König Wenzels festzulegen; Wenzel kommt der Aufforderung, in Oberlahnstein zu erscheinen nicht nach. |
| 1400 August 20 | Absetzung König Wenzels als römischen König; Nachfolger: Ruprecht III. von der Pfalz. Wenzel persönlich hat auf den Titel eines römischen Königs nie verzichtet und führt ihn auch weiterhin in Urkunden. |
| 1402 Mai- 1403 November |
2. Gefangennahme Wenzels; beteiligt: sein Bruder Sigismund |
| 1410 Mai 18 | König Ruprecht stirbt |
| 1410/1411 | Nachfolge: Doppelwahl zum römischen König |
| 1410 September 20 | Wahl Sigismunds |
| 1410 Oktober 1 | Wahl Jost von Mährens |
| 1411 Januar 18 | Jost von Mähren stirbt |
| 1411 Juli 21 | Sigismund wird römischer König; u.a. mit Hilfe seines Bruders Wenzel |
| 1419 August 16 | Wenzel stirbt in Prag |
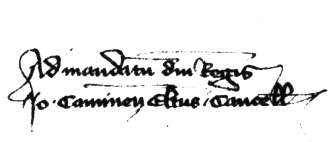
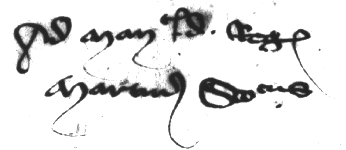
2. Im Auftrag eines Relators ausgestellte Urkunden
1) Ad relationem...
2) Per dominum...
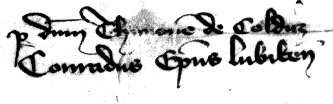
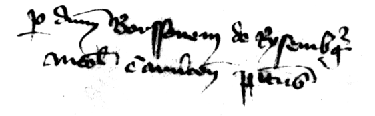
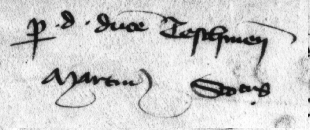
3. Sonderform
3) Ad commissionem tocius consilii...
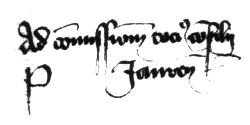
Liste der Relatoren und Kanzleimitglieder, in der Reihenfolge ihres Auftretens in den Urkunden (nach Hlavácek aufgelöst):
1. Relatoren
Wenzel von Luxemburg (lantgravium Luxemburgensem)
Johannes von Jenstein (Johannem Missensem episcopum)
Borso von Riesenberg (Borssonem de Rysenberg)
Peter von Jauer (Peter Jaurensis; Petrus Jawrensis; Peter Jauweren)
Premek von Teschem (ducem Tesschinensem)
Kunat Kappler (Kepplerum magistrum monete)
Borivoj von Svinare (Borziboij de Swynare; Borziwoy de Swinarz; Borziwoi de Swinarz)
Günther von Schwarzburg (Guntherum comitem de Swarczburg)
Wenzel Králík von Burenice (Wenzel patriarcham Antiochie cancellarium; Wenceslavi decani Wissegradensis)
Sigismund Huler (Sigmundi Subcamararii)
Heinrich von Brieg (Henricum Bregensem)
2. Kanzleimitglieder:
Nikolaus von Riesenberg (Nicolaus Camericensis)
Martin von Gewicz (Martinus scolasticus, Martinus cancellarius)
Konrad von Geisenheim (Conradus episcopus Lubikensis)
Wlachnik von Weitmühl (Wlachnico oder Wlachniko de Weytenmule)
(H. LUB prepositus cancellarius)
Hanko Brunonis aus Prag (Johannes Caminensis)
Wilhelmus Kortelangen
Johannes Lust
Franziskus von Gewicz
Bartholomäus von Neustadt (de nova civitate)
Franz, Propst von Nordhausen (Franziscus prepositus Northusen)
Johannes de Bamberg
3.2 Der Registervermerk (RV)
Der eventuell vorhandene Registervermerk diente dazu, die Kollationierung
von Registereintrag und Original zu bestätigen. Er erscheint entweder
in der Form eines Majuskel-R oder der Abkürzung Rta für "registrata".
Oft wird der ebenfalls abgekürzte oder auch vollständige Name
des Registrators hinzugesetzt. In der Regel befindet er sich im oberen
Drittel der Urkundenrückseite. Aus Wenzels Kanzlei hat sich kein Register
im Original erhalten. Nachrichten über sie bieten allein spätere
Abschriften oder vereinzelte Erwähnungen.
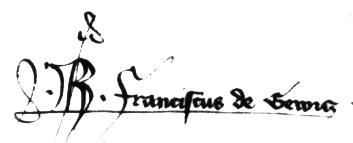
3.3 Klassifikation der Schriftstücke
3.3.1 Die Diplome
Diplome sind mit einem anhängenden Majestätssiegel versehen.
Unterschiede in der Ausstattung der Diplome (Majestätssiegel an Seidenfäden,
neben den Grundformeln findet man auch Arenga, Sanctio und Indiktion) machen
ein weitere Unterscheidung nach Privilegien und gewöhnlichen Diplomen
möglich. Die Publicatio beginnt in der Regel mit "Notum facimus/Bekennen"
oder mit "Embieten". Der Beschreibstoff ist meist Pergament.
3.3.2 Mandate
Mandate sind mit anhängenden kleinen Siegeln (Sekretsiegel) oder mit
aufgedrückten kleinen Siegeln, die allerdings nicht verschließen,
versehen. Sie sind in ihrer äußeren Form grundsätzlich
schlichter gestaltet als Diplome. Verewigungsformel, Arenga, Sanctio fehlen,
die Corroboratio ist knapper gehalten und die Registervermerke sind in
ihrer graphischen Gestaltung einfacher gehalten. Die Datierung erfolgt
vollständig. Nach der vollen Intitulatio folgt die Notifikation mit
"Notum facimus" oder die konkrete Adresse. Mandate könne sowohl auf
Pergament , wie auch auf Papier geschrieben worden sein.
Inhaltlich differenziert Hlavacek zwischen Diplomen und Mandaten folgendermaßen:
"Die erste Gruppe [Diplome] bilden somit Schriftstücke der inneren
[Zentral-]Verwaltung im engeren Sinne, in der zweiten Gruppe [Mandate]
handelt es sich meist um Eingriffe der Zentrale in die Kompetenz der fremden
und lokalen Behörden und Personen, sofern ihre Tätigkeit mit
der Intention des Hofes nicht im Einklang stand oder in irgendeiner Weise
beeinflußt werden sollte." (Hlavacek, S. 55)
3.3.3 Briefe
Briefe haben in der Regel bloßen Mitteilungscharakter ohne jede Rechtskraft,
die gleichwohl aber formgebunden sind. Da der Inhalt eher vertraulich ist,
wird zur Wahrung der Geheimhaltung und zur Beglaubigung (litterae clausae)
eine verschließende Sekret-Versiegelung vorgenommen. Die Intitulatio
steht zweizeilig über dem Text, alle entbehrlichen Protokollformeln
werden in der Regel weggelassen. Die Datierung ist im Gegensatz zu Diplomen
und Mandaten reduziert und der Ausstellungsort fehlt oft ganz. Wegen der
verschlossenen Briefform steht die Adresse auf der Rückseite. Briefe
sind auf Papier geschrieben.
4. Siegel
|
An den beschriebenen Wenzel-Urkunden wurden fünf verschiedene Siegel gefunden,
die nach Posse zitiert werden:
a) Majestätssiegel: Posse II 8-1 b) Sekretsiegel: Posse II 8-2 c) Älteres Rücksiegel: Posse II 7-3 d) Jüngeres Rücksiegel: Posse II 7-4 e) Hofgerichtssiegel: Posse II 9-1/2 |
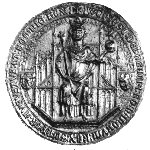 |
Hauptabteilung I Urkunden | |
| 1. Hessisches Samtarchiv | 21 |
| 2. Staatsarchiv Marburg | |
| A. Landgrafschaft Hessen | |
| I. Landgräfliches Archiv | 3 |
| II. Hessische Kloster- und Kirchenarchive | |
| Marburg Deutsch Orden | 1 |
| V. Hessische Dörfer und Städte | |
| Stadt Cassel | 1 |
| Stadt Hersfeld | 2 |
| I. Grafschaft Katzenelnbogen | 2 |
| M. Stift Hersfeld | 3 |
| O. Grafschaft Hanau | |
| I. Gräfliches Archiv | |
| b. Kaiserliche Privilegien und Pfandsachen | 2 |
| d. Auswärtige Beziehungen | 2 |
| g. Ämter, Orte und Beamte | 2 |
| q. Passivlehen | 2 |
| II. Fremde Archive | |
| a. Dynasten und Städte | |
| Stadt Gelnhausen | 5 |
| Burg Gelnhausen | 1 |
| e. Adel | |
| von Speyer-Wiss | 3 |
| R. Reichsabtei Fulda | 1 |
| W. Fürstentum Waldeck | 2 |
| X. Deposita, | |
| V. Familien | |
| von der Tann | 1 |
| Y. Urkundensammlung | |
| Bodmann-Habel | 7 |
| Hauptabteilung II Akten | |
| 1. Hessisches Samtarchiv, Nachträge | 8 |
| 2. Politische Akten vor Landgraf Philipp | |
| Kaiser und Reich, Karl IV. bis Albrecht | 4 |
| 340. Familienarchive und Nachlässe | |
| Rau von Holzhausen | 4 |
| Hauptabteilung III Amtsbücher | |
| 5. Kopialbücher | 16 |
| Abschr. | Abschrift |
| Ausf. | Ausfertigung | gen. | genannt |
| Kg. | König |
| Mgf. | Markgraf |
| Pap. | Papier |
| Perg. | Pergament |
| RKV | Relationskonzeptvermerk |
| RV | Registraturvermerk |
| Sgl. | Siegel |
| StA | Staatsarchiv |
 Zurück zur Homepage
Zurück zur Homepage